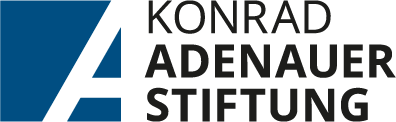Bildung und Arbeit in der DDR
Stell Dir vor, Du hast die Garantie auf einen Ausbildungsplatz. Anschließend wartet ein sicherer Arbeitsplatz auf Dich. Du lebst in einem Land, in dem es fast keine Arbeitslosigkeit gibt. Klingt verlockend, nicht wahr? In der DDR war dies Realität. Doch hinter dieser Fassade der Sicherheit und Chancengleichheit verbarg sich eine strenge staatliche Kontrolle, die das Leben der Menschen, ihre Träume und ihre berufliche Zukunft bestimmte.
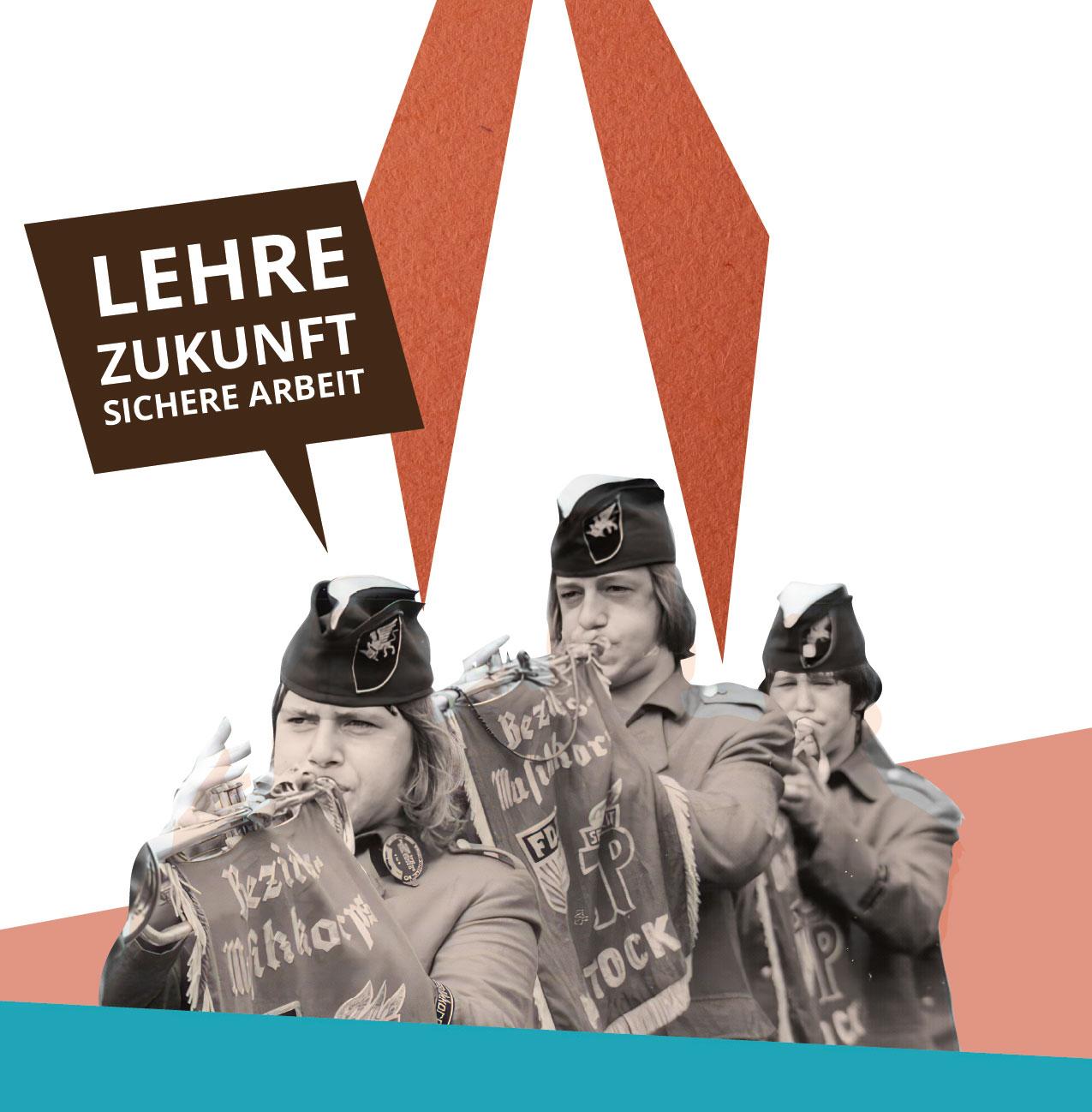
Stefan, ein Junge mit gebrochenen Flügeln
Stefan, aufgewachsen in einer Plattenbausiedlung in Thüringen, träumte davon, Pilot zu werden. Er war ein aufgeweckter und guter Schüler mit einer Leidenschaft für Flugzeuge und einer Begabung für Mathematik und Physik. Er baute Modellflugzeuge und las alles über die Fliegerei. Doch in der DDR wurden Träume oft von der Planwirtschaft* zerschlagen.

In einem Beratungsgespräch in der 8. Klasse wurde Stefan unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sein Berufswunsch sei unrealistisch, die DDR brauche keine Piloten, sondern Facharbeiter für die Industrie. Ihm wurde deutlich nahegelegt, einen "nützlichen" Beruf zu ergreifen, der den Bedürfnissen der sozialistischen Wirtschaft entsprach. Stefan fühlte sich unverstanden und in seinen Möglichkeiten eingeschränkt. Widerwillig begann er eine Ausbildung zum Maschinenbauer - ein Beruf, der ihn nicht erfüllte. Doch er hatte keine Wahl. Hätte er sich geweigert, hätte das weitreichende Folgen haben können:
Stefan hätte möglicherweise einen viel schlechteren oder gar keinen Ausbildungsplatz bekommen. Die Verweigerung eines angebotenen Platzes konnte als Arbeitsverweigerung ausgelegt werden, was in der DDR mit Strafen geahndet wurde. Er wäre gesellschaftlich als "asozial" abgestempelt worden. Ohne Berufsabschluss wären Stefans Möglichkeiten im späteren Leben eingeschränkt gewesen. So beugte er sich dem System, wie viele andere auch, und begrub seinen Traum vom Fliegen.
Staatliche Lenkung und die Illusion der Chancengleichheit
Stefans Geschichte ist kein Einzelfall, sie ist exemplarisch für die Realität vieler junger Menschen in der DDR[1]. Die Geschichte verdeutlicht den Widerspruch zwischen den Versprechungen des sozialistischen Systems und der Realität in der DDR. Die staatliche Lenkung der Berufswahl war ein wichtiges Thema im Schulalltag. Der Bedarf für die Betriebe wurde jährlich neu bestimmt und an die Schulen und ihre Berufsberatungslehrer weitergegeben. Die Planwirtschaft diktierte, welche Berufe benötigt wurden, und wer sich nicht ins sozialistische System einfügen wollte, hatte kaum eine Chance, seinen eigenen Weg zu gehen. Obwohl die DDR-Verfassung jedem Bürger das Recht auf Arbeit garantierte, war die Berufswahl oft eine Farce. Die angebliche "Chancengleichheit" war eine Illusion, denn politische Zuverlässigkeit und Anpassung waren wichtiger als individuelle Fähigkeiten und Interessen.
Die "sicheren Arbeitsplätze" waren oft eintönig und boten wenig Raum für persönliche Entfaltung. Viele wurden früh in ihrem Leben auf einen bestimmten Weg gedrängt, ohne die Möglichkeit zu haben, ihre eigenen Interessen und Talente zu entdecken und zu entfalten. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung wurde dadurch stark eingeschränkt.
[1] Laut einer Umfrage des Zentralinstituts für Jugendforschung Leipzig aus dem Jahr 1985 konnten 41 Prozent der Befragten ihren Wunschberuf erlernen, während 45 Prozent einen völlig anderen Beruf erlernten.
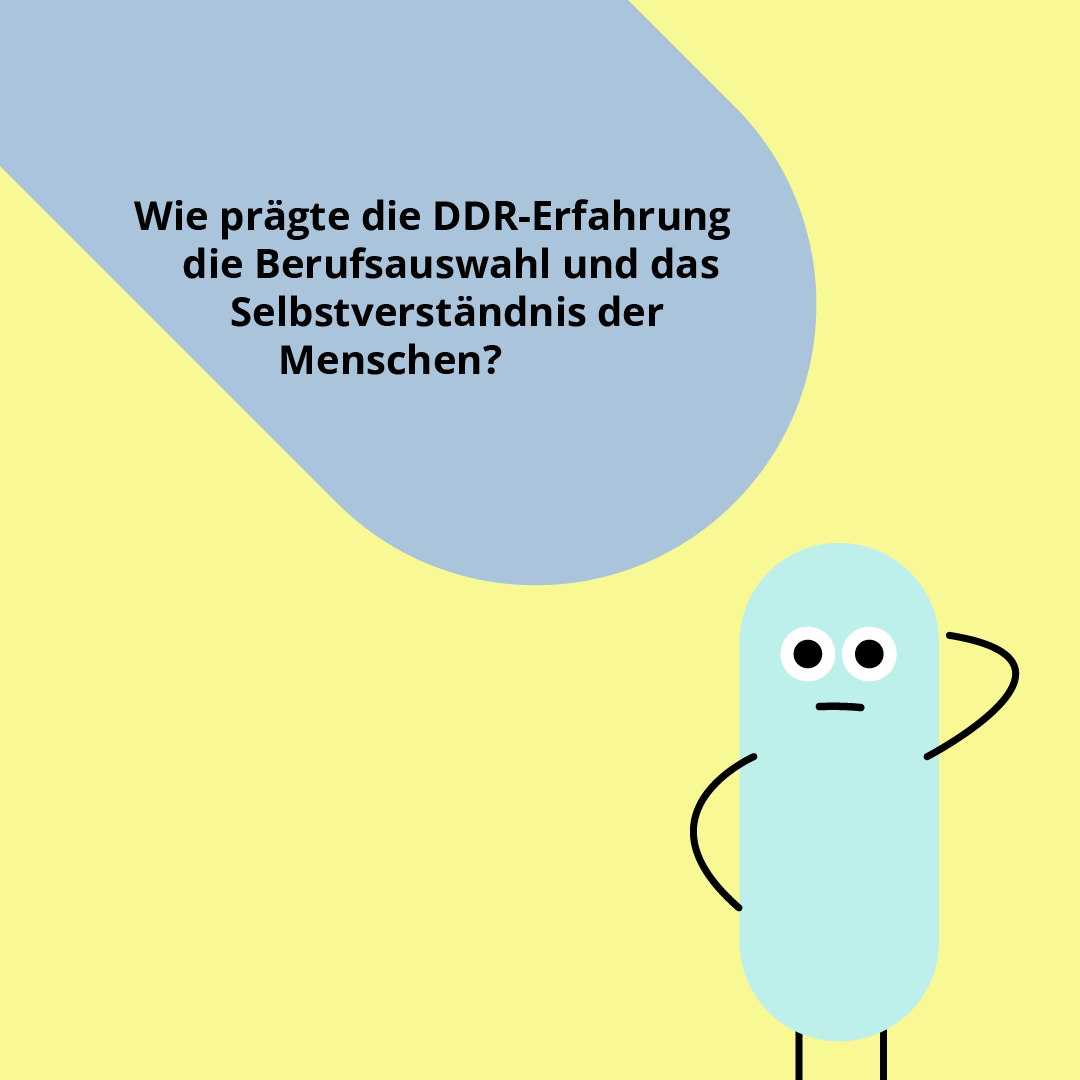
Pflicht zur Arbeit und sozialistische Prägung
Im sozialistischen System der DDR war Arbeit weit mehr als nur ein Mittel zum Lebensunterhalt. Sie wurde als moralische Pflicht und als Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe angesehen. Diese Überhöhung der Arbeit war tief in der sozialistischen Ideologie verankert, welche die Arbeit als zentralen Motor des gesellschaftlichen Fortschritts und als Mittel zur Verwirklichung einer klassenlosen Gesellschaft ansah.
Die DDR garantierte zwar jedem Bürger das Recht auf Arbeit, doch gleichzeitig bestand eine gesetzliche Pflicht zur Arbeit. Wer sich dieser Pflicht entzog, wurde nicht nur gesellschaftlich geächtet, sondern riskierte auch strafrechtliche Verfolgung. Diese Regelung diente nicht nur der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, sondern auch der Erfüllung der wirtschaftlichen Ziele der Planwirtschaft.
Die sozialistische Prägung erstreckte sich auch auf das Bildungssystem. Von der Schule bis zur Universität wurde die Gesellschaft auf die sozialistische Gesellschaftsordnung eingeschworen und die Menschen zu linientreuen Staatsbürgern erzogen. Kritische Meinungen und abweichende Weltanschauungen wurden unterdrückt, was zu einer Einschränkung der individuellen Freiheit und der Meinungsfreiheit führte.
Bildung und Träume in der DDR
Anja und Monika - zwei Freundinnen, zwei Wege
Anja und Monika, unzertrennlich seit ihrer ersten Begegnung in der ersten Klasse, teilten alles: ihre Träume, ihre Geheimnisse und ihre tiefe Leidenschaft für die Kunst. Doch in der DDR, wo politische Konformität oft über Talent und Begabung gestellt wurde, mussten sie erfahren, dass sie Umwege gehen oder Kompromisse eingehen mussten, um ihre Träume zu verwirklichen.

Anjas Kampf: Die Kunst der Rebellion
Anja, eine begabte Zeichnerin mit einem scharfen Blick für die Realität, träumte davon, Illustratorin zu werden. Ihre künstlerische Begabung wurde früh erkannt, doch ihre Werke, die die Umweltverschmutzung und die Sehnsucht nach Freiheit thematisierten, missfielen ihren Lehrern. Kunst sollte den Sozialismus verherrlichen, nicht kritisch hinterfragen. Anjas Noten in Kunst sanken, und ihr Traum von der Kunsthochschule schien in Gefahr. Sie fühlte sich unverstanden und eingeengt, gefangen in einem System, das ihre künstlerische Freiheit beschnitt.
Monikas Dilemma: Talent ohne Parteibuch
Monika, Anjas beste Freundin, war eine brillante Schülerin mit einem ausgeprägten Sprachtalent. Ihr Berufswunsch: Journalistin. Sie war eine Musterschülerin, engagierte sich in der FDJ und wurde von ihren Lehrern gefördert. Doch ein Makel überschattete ihre Zukunft: Ihre Eltern waren keine Parteimitglieder. Als sie sich für die Erweiterte Oberschule (EOS) bewarb, um das Abitur zu machen und ihrem Traum näher zu kommen, wurde sie abgelehnt. Ihre Lehrer waren enttäuscht, aber sie wussten, dass politische Kriterien oft mehr Gewicht hatten als Talent und Fleiß.
Die beiden Freundinnen standen vor einer ungewissen Zukunft. Anja kämpfte gegen die Zensur und für ihre künstlerische Freiheit, während Monika mit der bitteren Realität konfrontiert wurde, dass ihre Herkunft ihre Bildungschancen einschränkte.
Das Bildungssystem der DDR: Instrument der "Erziehungsdiktatur"
Das Bildungssystem der DDR war eng mit der sozialistischen Ideologie und den politischen Zielen der SED verknüpft. Es diente nicht nur der Wissensvermittlung, sondern vor allem der Erziehung linientreuer Staatsbürger. Die Partei wollte damit ihren Machterhalt sichern und systemkonformen Nachwuchs heranziehen. Lehrkräfte hatten dabei eine Doppelfunktion inne: Sie sollten sowohl Wissen vermitteln als auch die politische Erziehung der Schüler sicherstellen. Ihre Arbeit war streng reglementiert und unterlag ständiger Beobachtung und Kontrolle.
Die DDR verfolgte das ambitionierte Ziel eines einheitlichen Bildungssystems, das allen Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen eröffnen sollte:
Die Säulen des Bildungssystems
(1) Die Polytechnische Oberschule (POS): Das Fundament des DDR-Bildungssystems
Im Zentrum dieses Systems stand die Polytechnische Oberschule (POS), die für alle Schüler verpflichtend war und eine zehnjährige Schulzeit umfasste. Die POS hatte den Auftrag, eine breite Allgemeinbildung zu vermitteln, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den sogenannten MINT-Fächern also Mathematik, Naturwissenschaften und Technik lag.
Das Konzept der POS ging jedoch über die reine Wissensvermittlung hinaus. Es war tief in der sozialistischen Ideologie verwurzelt und zielte darauf ab, den sozialistischen Nachwuchs nicht nur intellektuell, sondern auch praktisch auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Durch die Integration von praktischen Erfahrungen in Betrieben und die Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten sollten die Schüler frühzeitig an die Anforderungen der sozialistischen Produktion herangeführt werden.
(2) Die betriebliche Berufsausbildung (BBS): Sprungbrett in die Arbeitswelt
Die Berufsausbildung in der DDR war eng mit dem Konzept der Betriebsberufsschule (BBS) verknüpft, die einen zentralen Baustein im Bildungssystem darstellte. Dieses duale System kombinierte die praktische Ausbildung direkt im Betrieb mit theoretischem Unterricht in der Berufsschule. Ziel war es, qualifizierte Facharbeiter hervorzubringen, die sowohl über fundiertes Wissen als auch über praktische Fähigkeiten verfügten, um den Anforderungen der sozialistischen Wirtschaft gerecht zu werden.
Die BBS bot eine attraktive Perspektive für viele Schüler nach Abschluss der 10. Klasse. Sie garantierte nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz in einem staatlichen Betrieb oder Kombinat*. Diese Aussicht auf berufliche Sicherheit war ein entscheidender Faktor für die hohe Attraktivität der Berufsausbildung in der DDR.
In Verbindung mit der dreijährigen Berufsausbildung konnte auch eine Hochschulreife erlangt werden. Über diesen Weg stand das Studium dann in der Regel in Verbindung zur vorherigen Berufsausbildung.
(3) Die Erweiterte Oberschule (EOS) und das Studium: Elitäre Bildung unter ideologischer Kontrolle
Nur ein kleiner Teil der Schüler hatte die Möglichkeit, das Abitur an der Erweiterten Oberschule (EOS) zu machen und damit den Weg zur Hochschule zu ebnen. Der Zugang zur EOS war jedoch streng reglementiert und an politische Kriterien geknüpft. Neben exzellenten Noten waren eine "einwandfreie" politische Haltung, die Mitgliedschaft in der Organisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) und die Teilnahme an der Jugendweihe entscheidend. Kirchliches Engagement oder oppositionelle Gedanken waren hingegen Ausschlusskriterien. Das betraf nicht nur das Verhalten der Schülerinnen und Schüler selbst, sondern auch das ihrer Eltern und Geschwister.
Der Zugang zu Hochschulen in der DDR war stark reguliert. Studienplätze waren begrenzt, und im Durchschnitt begannen in den 1980er Jahren nur etwa 12-13% eines Jahrgangs ein Hochschulstudium. Neben fachlichen Qualifikationen spielte die politische Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Studierenden. Die Hochschulen waren nicht nur Orte der Wissensvermittlung und Forschung, sondern dienten auch der ideologischen Ausbildung. Das obligatorische "Gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium" vermittelte allen Studenten marxistisch-leninistische Grundlagen. Nach dem Abschluss nahm sich der Staat das Recht vor, über den Arbeitsort seiner Absolventen zu entscheiden.
Begriffserklärung
*Kombinat: Kombinate waren ein zentrales Element der DDR-Wirtschaft. Sie vereinten verschiedene Betriebe einer Branche unter einem Dach – von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Produkt. Oftmals gehörten auch Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen dazu. Diese Struktur bot Absolventen der Berufsausbildung vielfältige Perspektiven: sichere Arbeitsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Ein Beispiel ist das Energiekombinat VEB Schwarze Pumpe, das Braunkohleförderung, -verarbeitung und Stromerzeugung vereinte.
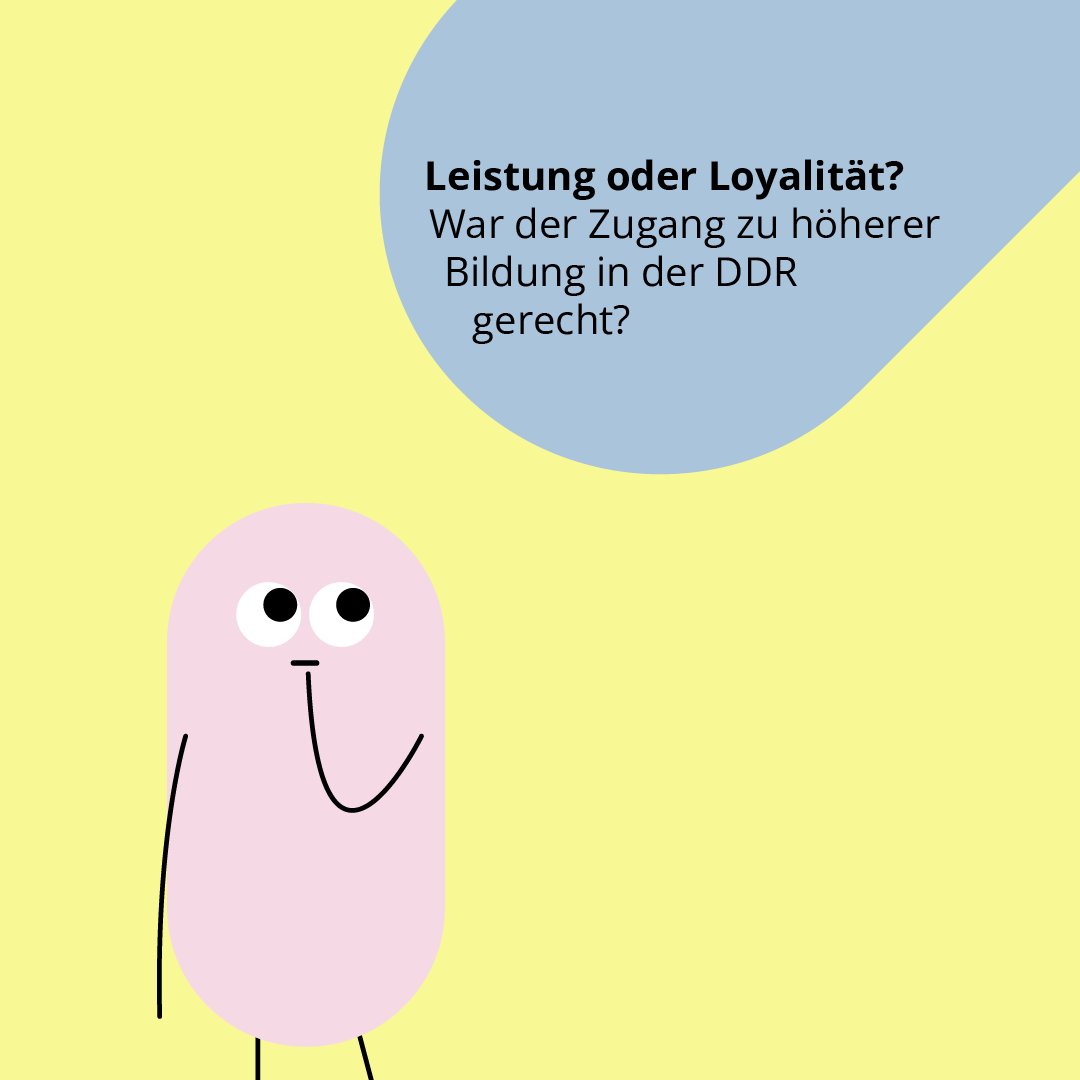
Das Bildungssystem der DDR war von einer strengen Auswahl und ideologischen Kontrolle geprägt. Der Zugang zu höherer Bildung war nicht allein von Leistung abhängig, sondern auch von der politischen Gesinnung.