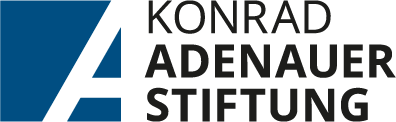Lebensrealität in einer Diktatur
Die DDR war ein sozialistischer Staat mit einer Einparteiendiktatur. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) hatte die absolute politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik. Die SED beherrschte alle Bereiche des Staates und der Gesellschaft, ließ keine Opposition zu und kontrollierte die Medien, die Bildung und die Kultur. Nahezu alle wichtigen Positionen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft waren mit SED-Mitgliedern besetzt.

Wie war es möglich, dass die SED eine solch umfassende Kontrolle in der DDR erlangen und aufrechterhalten konnte?
Die Macht der SED war das Ergebnis eines ausgeklügelten Systems, das auf dem Prinzip des Demokratischen Zentralismus* basierte.
Dieses Organisations- und Führungsprinzip, das von Lenin als Strukturprinzip für kommunistische Parteien entwickelt worden war, diente als Grundlage der Herrschaftssysteme in den sogenannten "realsozialistischen" Staaten, einschließlich der DDR. Die SED übernahm dieses System und weitete es auf den gesamten Staatsapparat aus. Sie unterdrückte jegliche Form von politischem Pluralismus* oder Opposition, was zu der oben genannten Einparteiendiktatur führte. Obwohl es diverse weitere Parteien gab, waren diese in der sogenannten "Nationalen Front" unter Führung der SED zusammengefasst und besaßen keinerlei eigenständige politische Entscheidungsgewalt. Die Wahlen* zur Regierungsbildung waren Scheinwahlen ohne wirkliche Alternativen für die Bevölkerung.
Begriffserklärungen
*Demokratischen Zentralismus: Wichtig ist hier zu verdeutlichen, dass der Begriff "Demokratie" im Kontext der DDR nicht mit dem Verständnis von Demokratie in westlichen Gesellschaften gleichzusetzen ist. Er wurde von der SED ideologisch umgedeutet und diente zur Verschleierung der tatsächlichen Machtverhältnisse. Der Demokratische Zentralismus verbindet zwei scheinbar gegensätzliche Konzepte: Demokratie und Zentralismus. Die Theorie besagt, dass nach einer demokratischen Entscheidungsfindung innerhalb der Partei, alle Mitglieder die getroffene Entscheidung diszipliniert umsetzen und nach außen vertreten müssen, auch wenn sie persönlich anderer Meinung sind. Dies soll eine einheitliche und handlungsfähige Partei gewährleisten. In der Praxis führte der Demokratische Zentralismus jedoch oft zu einem Machtmissbrauch, weil die Zentralisierung der Macht jegliche abweichende Meinung unterdrückten konnte. Kritische Stimmen wurden mundtot gemacht, und die Bevölkerung hatte keine Möglichkeit, ihre politischen Vertreter frei zu wählen oder Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen.
*Wahlen: Es gab keine Möglichkeit, sich zu enthalten oder nicht zur Wahl zu gehen. Die Teilnahme an den Wahlen war verpflichtend, und jede Form des Boykotts wurde als "staatsfeindliche Handlung" geahndet.
*politischer Pluralismus: Bezeichnet ein politisches System, in dem mehrere Parteien und politische Gruppierungen existieren und miteinander konkurrieren können. Es beinhaltet Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und freie Wahlen, die eine Vielfalt von politischen Ansichten und Interessen ermöglichen.
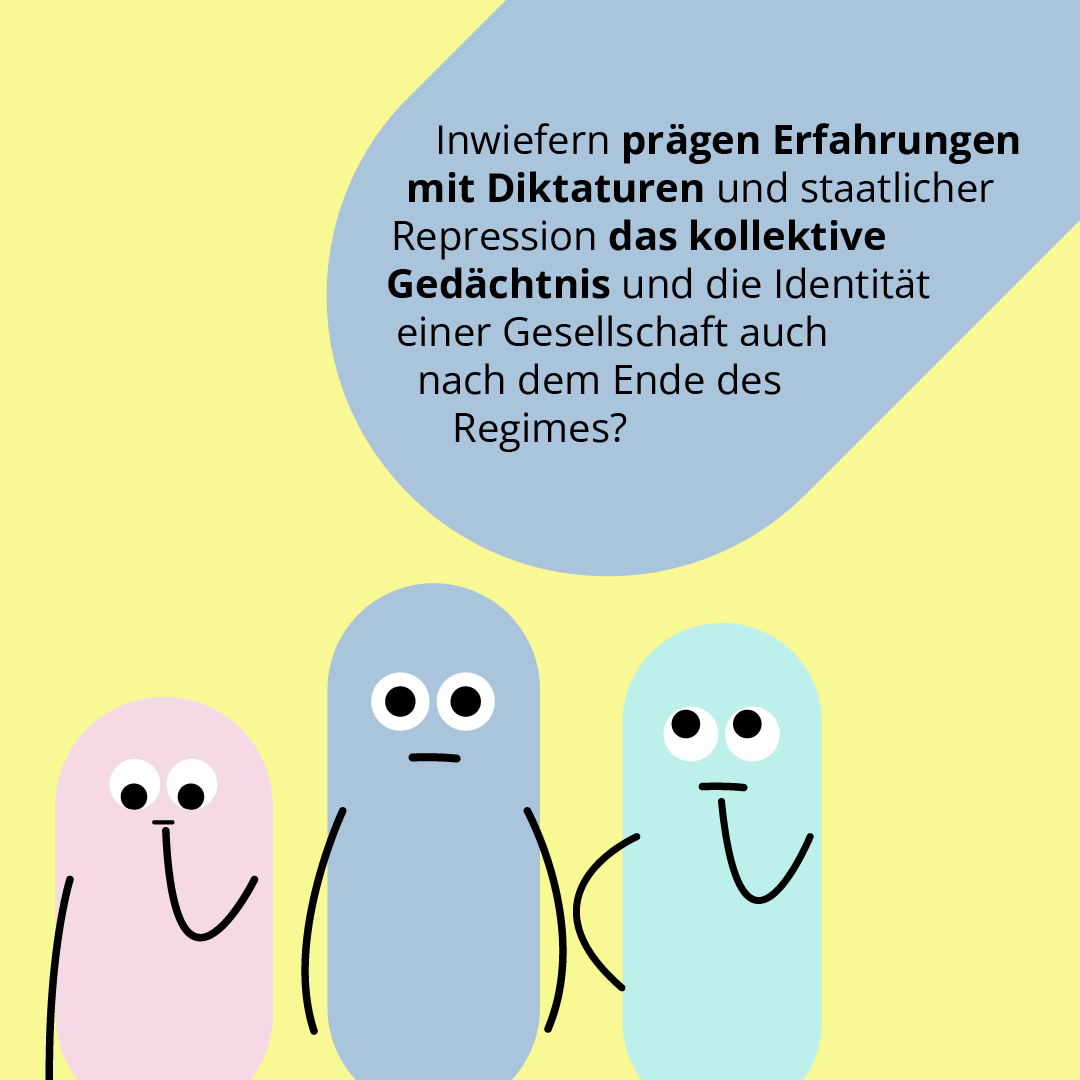
Staatsaufbau der DDR: Schein und Wirklichkeit
Der Staatsaufbau der DDR präsentierte sich nach außen hin als ein System mit demokratischen Elementen, in dem die Bürgerinnen und Bürger an der Wahl ihrer Vertreter beteiligt waren. Eine echte Repräsentation der Bevölkerung war jedoch nicht gegeben.
- Volkskammer: Das formell oberste Staatsorgan war die Volkskammer, deren Abgeordnete über eine Einheitsliste der Nationalen Front gewählt wurden. Beschlüsse wurden bis 1989 fast immer einstimmig gefasst. Die Volkskammer war nur ein „Scheinparlament“.
- Staatsrat: Die Volkskammer wählte den Staatsrat, der weitreichende Befugnisse hatte, einschließlich der Gesetzgebung und der Ernennung von Richtern. Der Staatsrat wurde aber faktisch von der SED kontrolliert.
- Ministerrat: Der Ministerrat bildete die Regierung der DDR und war für die Umsetzung der politischen Entscheidungen verantwortlich, die zuvor in der SED-Führungsspitze getroffen worden waren.
- Justiz: Die Justiz war dem politischen Einfluss der SED unterworfen. Richter wurden vom Staatsrat ernannt und waren an die Vorgaben der SED gebunden.
- Lokale Verwaltung: Die DDR war in 15 Bezirke und 217 Kreise unterteilt. Auf jeder Ebene gab es örtliche Volksvertretungen und Räte der Bezirke und der Kreise, die formal gewählt wurden. Ihre Entscheidungskompetenzen waren jedoch sehr begrenzt und wurden auch vor Ort von der SED bestimmt. Föderalismus, wie etwa in der Bundesrepublik, gab es in der DDR nicht.
Drei Charaktere, drei Perspektiven auf die DDR
Gerda Müller (geb. 1925): Die überzeugte Sozialistin
Gerda wuchs in einer Arbeiterfamilie in Berlin auf und erlebte die Schrecken des Zweiten Weltkriegs hautnah. Sie verlor ihren Vater an der Front und ihre Mutter starb bei einem Bombenangriff auf ihre Heimatstadt. Gerda war traumatisiert und wünschte sich eine bessere und friedlichere Welt.

Inmitten der Trostlosigkeit des zerstörten Berlins, fand Gerda Hoffnung in den sozialistischen Idealen der SED. Sie glaubte fest daran, dass der Sozialismus eine gerechtere und friedlichere Gesellschaft schaffen würde. Mit Leidenschaft engagierte sie sich in der Partei und wurde Lehrerin, um die junge Generation im Geiste des Sozialismus zu erziehen und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Gerda unterstützte die SED-Politik weitgehend und sah in der DDR eine Verwirklichung ihrer sozialistischen Ideale. Sie akzeptierte die Einschränkungen der Freiheit als notwendiges Übel, um eine Rückkehr zum Faschismus zu verhindern.
Auch in ihren späten Jahren blieb Gerda der SED treu, obwohl sie zunehmend kritisch gegenüber einigen Entwicklungen wurde.
Hans Schmidt (geb. 1950): Der angepasste Opportunist
Hans wuchs in einem Neubaugebiet in Rostock auf und genoss eine unbeschwerte Kindheit in der DDR. Er erlebte den wirtschaftlichen Aufschwung der 1960er Jahre. Er trat der FDJ bei und machte eine Ausbildung zum Ingenieur. Er war kein überzeugter Sozialist, aber er akzeptierte das System und nutzte die Möglichkeiten, die es ihm bot.

Anja Lehmann (geb. 1964): Die unzufriedene Dissidentin
Anja wuchs in einem Dorf in der Nähe von Erfurt auf. Sie erlebte die Widersprüche des Systems und die wirtschaftliche Stagnation der 1980er Jahre. Sie sehnte sich nach Freiheit und Reisemöglichkeiten und war fasziniert von der westlichen Kultur.

Als Krankenschwester in einem städtischen Krankenhaus hatte sie täglich Kontakt mit Menschen und ihren Sorgen. Dies bestärkte ihren Wunsch nach Veränderung. Sie träumte von einem demokratischen Sozialismus und einer offenen Gesellschaft. Anja schloss sich einer kirchlichen Oppositionsgruppe an und engagierte sich für Menschenrechte und Demokratie. Sie nutzte ihre berufliche Position, um Informationen zu verbreiten und Menschen zu unterstützen.
In der Opposition lernte Anja ihren späteren Ehemann kennen. Ihre gemeinsame Überzeugung schweißte sie zusammen. Doch durch die ständige Überwachung und Repression der Stasi wurde ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Beide beteiligten sich an den Montagsdemonstrationen und trugen zur friedlichen Revolution von 1989 bei.
Freiheitsbeschränkungen in der DDR: Ein Leben unter ständiger Beobachtung
Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo Freiheit ein Grundrecht war, wurde sie in der DDR streng kontrolliert und zugeteilt. Freiheit war ein Privileg, das der Staat seinen Bürgern nur unter bestimmten Bedingungen und nach seinen Vorstellungen gewährte.
Der Alltag war geprägt von zahlreichen Einschränkungen und der ständigen Überwachung durch das Ministerium für Staatssicherheit, die gefürchtete Stasi. Die Menschen konnten ihre Meinung nicht offen äußern, denn die Stasi war allgegenwärtig – selbst private Gespräche waren nicht sicher vor den Ohren des Überwachungsapparates. Jeder konnte ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi sein, Informationen sammeln und weitergeben – Misstrauen prägte das gesellschaftliche Klima.
Die Reisefreiheit war stark eingeschränkt. Selbst Reisen innerhalb des sozialistischen Auslands waren ein selten gewährtes Privileg. Andere Kulturen und Lebensrealitäten jenseits des Eisernen Vorhangs blieben der Mehrheit der DDR-Bevölkerung verwehrt. Selbst für Familienzusammenkünfte und andere Reisen in den Westen musste eine besondere Ausreisegenehmigung beantragt werden, die oft abgelehnt wurde.

Was passierte mit denen, die sich nach Freiheit sehnten und versuchten, die DDR ohne Erlaubnis zu verlassen?
Diese Menschen riskierten ihr Leben. Die Berliner Mauer, die 1961 errichtet wurde, blieb für viele Menschen ein unüberwindbares Hindernis, das mit Stacheldraht, Selbstschussanlagen und bewaffneten Grenzposten gesichert war. Viele Fluchtversuche endeten tragisch. So wie im Fall von Peter Fechter, der im August 1962 bei dem Versuch, die Mauer zu überwinden, von Grenzsoldaten angeschossen wurde und verblutete. Oder Chris Gueffroy, der im Februar 1989 nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer erschossen wurde.
Wer bei einem Fluchtversuch erwischt wurde, musste mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Auch die Familien der Betroffenen waren ab diesem Zeitpunkt den Schikanen des Machtapparates ausgesetzt. Die Stasi verfolgte alle im eigenen Land, die sich gegen das Regime auflehnten. Der Widerstand der Menschen sollte umfassend unterdrückt werden. Die Methoden und Vorgehensweisen der Stasi waren vielfältig, drastisch und effizient: Überwachung, Verhaftungen, Einschüchterung oder psychische Folter waren an der Tagesordnung. Die DDR-Justiz hat unzählige Menschenrechtsverletzungen zu verantworten. Unzählige Menschen wurden durch die DDR-Justiz verurteilt, die keine unabhängige Instanz war, sondern als Instrument der SED zur Kontrolle und Machterhaltung diente.
Zwei Schicksale im Schatten der Stasi
Erika Meier (37 Jahre): Die Hüterin der verbotenen Worte
Erika, eine leidenschaftliche Bibliothekarin in Dresden, sah ihren Beruf als Berufung. Sie liebte es, Menschen den Zugang zu Wissen und Literatur zu ermöglichen und betrachtete die Bibliothek als einen Ort der Freiheit und des geistigen Austauschs. Doch in der DDR war auch die Literatur streng kontrolliert. Erika geriet in Konflikt mit dem Regime, als sie sich weigerte, bestimmte Bücher aus dem Bestand zu entfernen, die von der SED als “staatsfeindlich" eingestuft wurden.

Die Stasi begann, Erikas Leben in einen Albtraum zu verwandeln. Zunächst subtil: Möbel wurden in ihrer Wohnung leicht verschoben, persönliche Gegenstände verschwanden. Ihr Telefon knackte bei Gesprächen, und sie hatte das beklemmende Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Dann wurde es offensichtlicher: Gerüchte wurden über sie verbreitet, ihre Kollegen wurden gegen sie aufgehetzt, und selbst ihre Stammleser begannen, sie zu meiden. Erika verfiel in tiefe Verzweiflung und begann, an ihrem Verstand zu zweifeln.
Schließlich wurde sie unter dem Vorwand der "Verbreitung staatsfeindlicher Literatur" verhaftet. In der Untersuchungshaftanstalt der Stasi wurde Erika tagelangen Verhören und psychischer Folter ausgesetzt. Man drohte ihr mit der Inhaftierung ihrer Kinder, um ein Geständnis zu erzwingen. Gebrochen und verzweifelt unterschrieb Erika schließlich ein Geständnis für eine Tat, die sie nie begangen hatte.
Peter Hoffmann (23 Jahre): Der regimekritische Student
Peter, ein aufgeweckter und neugieriger junger Mann, studierte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hinterfragte die offizielle Geschichtsschreibung der DDR und suchte nach alternativen Quellen in der verbotenen Literatur. Er schloss sich einer kleinen Gruppe regimekritischer Studenten an, die sich "Die Freiheitsleser" nannten. Sie trafen sich heimlich in Privatwohnungen, um verbotene Bücher zu lesen und ihre Unzufriedenheit mit dem System auszutauschen.

Eines Abends wurde Peter nach einem Treffen der "Freiheitsleser" von der Stasi verhaftet. Man warf ihm "staatsfeindliche Umtriebe" vor und brachte ihn in die Untersuchungshaftanstalt. Dort wurde er in Isolationshaft gehalten und systematisch gebrochen. Schlafentzug, stundenlange Verhöre, Drohungen und Demütigungen waren an der Tagesordnung.
Peter hielt den psychischen Qualen anfangs noch stand. Aber die Stasi war unerbittlich, sie fanden immer neue Möglichkeiten, ihn unter Druck zu setzten. Sie wussten von der Krebserkrankung seiner Mutter und drohten, ihr die dringend benötigte medizinische Behandlung zu verweigern, sollte er nicht kooperieren. In seiner Verzweiflung und aus Liebe zu seiner Mutter gab Peter schließlich die Namen seiner Freunde preis. Die Schuldgefühle über diesen Verrat nagten noch lange an ihm, selbst, nachdem er aus der Haft entlassen worden war.
Die Geschichten von Erika und Peter zeigen beispielhaft die perfiden Methoden des DDR-Machtapparates, dem unzählige unschuldige Menschen zum Opfer fielen. Die Stasi schürte gezielt Misstrauen, zerstörte zwischenmenschliche Beziehungen und manipulierte ihre Opfer mit psychologischer Gewalt, bis diese zerbrochen und bereit waren, falsche Geständnisse abzulegen oder sogar Freunde zu verraten. Die Folgen dieser systematischen Menschenrechtsverletzungen sind für viele Betroffene bis heute traumatisch. Zahlreiche ehemalige politische Gefangene leiden unter den psychischen und physischen Spätfolgen ihrer Inhaftierung und der Zersetzungsmaßnahmen. Sie kämpfen mit Angstzuständen, Depressionen und Schuldgefühlen.