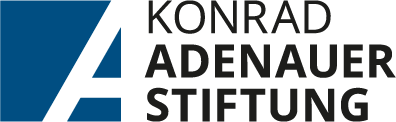Umwelt in der DDR
Die "braune" DDR: Die Planerfüllung und das Wirtschaftswachstum hatten absoluten Vorrang für die SED-Regierung. Umweltschutz war dabei hinderlich und wurde vernachlässigt.

Die traurige Umweltbilanz der Planwirtschaft
Die DDR war stark abhängig von Braunkohle als Energiequelle. Der Abbau und die Verbrennung verursachten enorme Schäden an Luft, Wasser und Boden. Ganze Landstriche wurden durch den Tagebau verwüstet.
Auch die chemische Industrie war ein wichtiger Wirtschaftszweig und gleichzeitig auch ein großer Umweltverschmutzer. Giftige Abwässer und Abgase wurden oft ungeklärt in die Umwelt geleitet. Dadurch waren viele Flüsse und Seen stark verschmutzt. An bestimmten Seen ging man besser nicht angeln, weil die Fische ungenießbar waren. Die Luft in vielen Städten war schlecht, besonders in Industriegebieten war die Konzentration von Schwefeldioxid hoch. Dies führte zu Atemwegserkrankungen und Allergien.
Die Landwirtschaft wollte ebenfalls hohe Erträge erzielen und setzte auf den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, die Böden und Gewässer stark belasteten. Durch die mangelnde Umweltregulierung war die Bevölkerung häufig gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Die starke Industrialisierung der DDR hatte zahlreiche negative Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur.
Das Umweltbewusstsein in der DDR entwickelte sich über die Jahrzehnte hinweg in enger Verknüpfung mit gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. Die zentralistische Planwirtschaft der DDR ließ anfangs wenig Raum für individuelle Initiativen und Umweltschutzbemühungen. Umweltprobleme wurden heruntergespielt oder vertuscht.
Die Bevölkerung hatte kaum Zugang zu Informationen über den Zustand ihrer Umwelt. Die DDR war knapp an Devisen und Rohstoffen. Dies führte dazu, dass auf billige, aber umweltschädliche Lösungen zurückgegriffen wurde. Auch der technologische Rückstand der DDR war Teil des Problems. Viele Industriebetriebe arbeiteten mit veralteten Technologien. Es fehlte an Investitionen in moderne, umweltfreundliche Anlagen.
Zeitlinie
In den frühen Jahren der DDR, den 1950ern und 60ern, lag ein Fokus auf dem Naturschutz. Interessanterweise galt zunächst das Reichsnaturschutzgesetz (RNG) von 1935 weiter, bevor 1954 ein eigenes Naturschutzgesetz in Kraft trat. Auch die Verfassung der DDR enthielt einen Passus zum Natur- und Umweltschutz, allerdings erst in der Fassung von 1968. Doch die Umsetzung blieb oft hinter den Ansprüchen zurück. So wurden beispielsweise Wälder für den Braunkohleabbau abgeholzt, Flüsse begradigt und Feuchtgebiete trockengelegt.
Mit dem wirtschaftlichen Wachstum in den 1970er Jahren wurden die Umweltprobleme immer offensichtlicher. Die Luft- und Wasserverschmutzung, die Zerstörung von Landschaften durch den Braunkohleabbau und die intensive Landwirtschaft führten zu wachsender Kritik. Erste kleine Umweltgruppen entstanden und begannen, die Umweltpolitik der SED zu hinterfragen.
In den 1980er Jahren nahm die Umweltbewegung in der DDR zunehmend Fahrt auf. Zahlreiche neue Gruppen vernetzten sich und machten öffentlichkeitswirksam auf Umweltprobleme aufmerksam. Die Kirche bot ihnen Schutzraum und Unterstützung. Die SED-Führung reagierte auf die wachsende Umweltbewegung mit Repression gegen die Aktivisten.
Die Umweltbewegung in der DDR leistete einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltprobleme. Die Gruppen organisierten unerlaubte Proteste, Demonstrationen und Mahnwachen, gaben Flugblätter und Zeitschriften heraus. Sie gründeten Bürgerinitiativen zum Schutz bestimmter Gebiete oder gegen konkrete Umweltverschmutzer. Das Thema Umwelt rückte dadurch stärker in den öffentlichen Fokus und die SED-Führung war zum Handeln gezwungen.
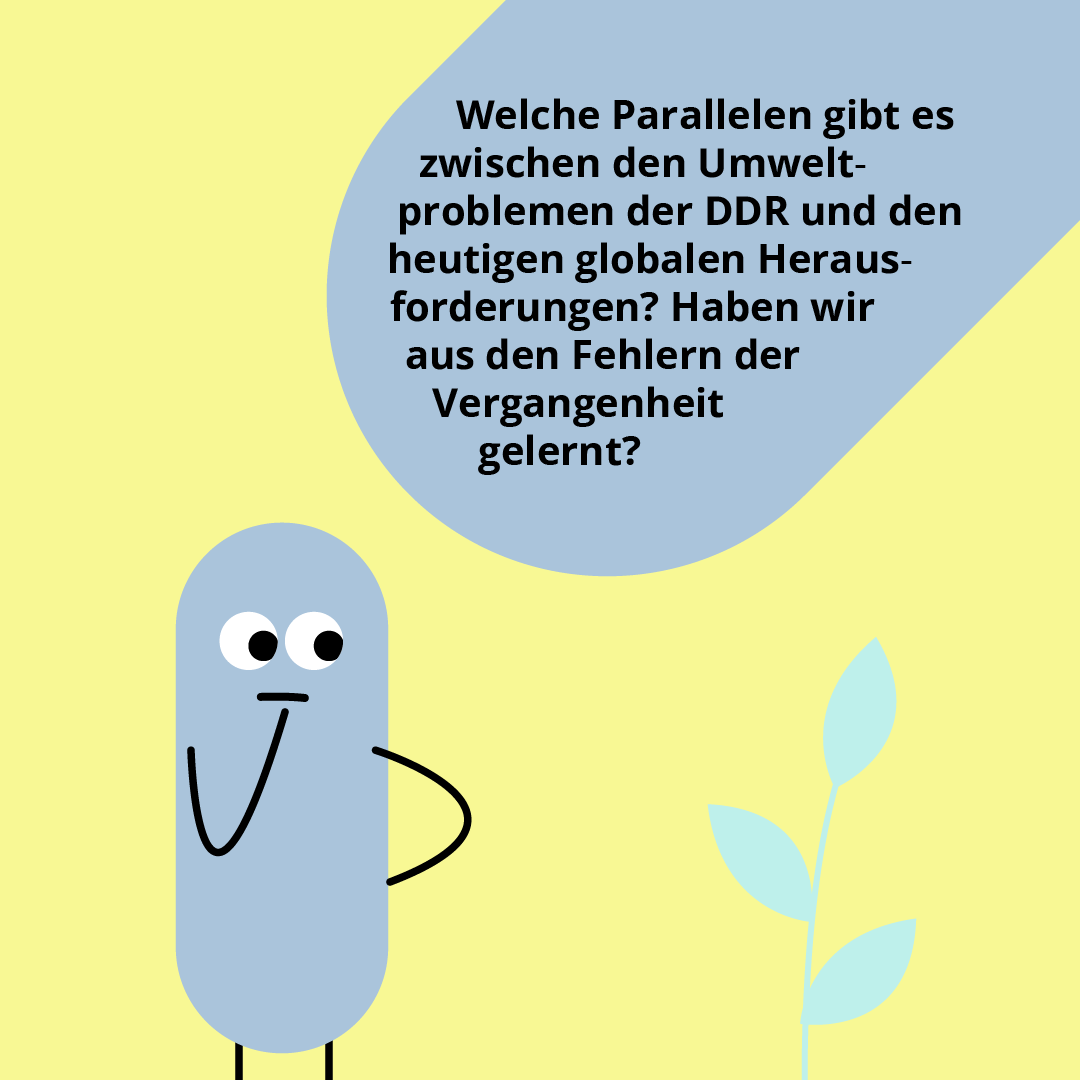
Staatliche Initiativen - Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Die SED-Führung versuchte, die Umweltbewegung zu kontrollieren und den Eindruck zu erwecken, der Staat kümmere sich um den Umweltschutz. Sie wollte die Kontrolle über die Umweltbewegung erlangen und deren Einfluss begrenzen, denn in den 1980er Jahren wurden die Umweltprobleme in der DDR immer offensichtlicher, und die Umweltbewegung gewann an Stärke. Umweltgruppen entwickelten sich zu einem wichtigen Teil der DDR-Opposition und forderten nicht nur Umweltschutz, sondern auch mehr Demokratie und Menschenrechte. Ein wichtiger Treffpunkt dieser Gruppen war die Umwelt-Bibliothek in der Zionskirchgemeinde in Berlin, die die einzige nicht staatlich kontrollierte Druckerei in der DDR beherbergte. Die SED-Führung sah in solchen Aktivitäten eine Bedrohung und versuchte, die Gruppen zu unterdrücken. Sie spürte den zunehmenden Druck und die Kritik an ihrer Umweltpolitik.
Zwar hatte die DDR bereits früh ein eigenes Naturschutzgesetz erlassen (1954) und den Umweltschutz in der Verfassung von 1968 verankert, doch die Umsetzung dieser Gesetze blieb oft hinter den Ansprüchen zurück. Auch weitere Umweltgesetze, wie das Landeskulturgesetz von 1970 und das Wassergesetz von 1971, konnten die zunehmende Umweltverschmutzung nicht verhindern. Oft fehlte es an den finanziellen Mitteln und dem politischen Willen, umweltfreundliche Maßnahmen konsequent umzusetzen. Die Beteiligung an internationalen Umweltprogrammen diente vor allem der Imagepflege im Ausland.
Umweltschutzgebiete und Umwelterziehung
Zu den ernstgemeinten Initiativen gehörte die Ausweisung von Naturschutzgebieten, wie dem Müritz-Nationalpark, dem Spreewald oder dem Nationalpark Sächsische Schweiz. Diese Gebiete sind wertvolle Lebensräume und stehen auch heute noch unter Schutz.
Die DDR integrierte Umweltthemen in den Schulunterricht und bot außerschulische Aktivitäten an, um die junge Generation für Umweltprobleme zu sensibilisieren. Kinder- und Jugendzeitschriften, Fernsehsendungen und Filme zu Umweltthemen vermittelten dabei oft ein idealisiertes Bild vom Umweltschutz in der DDR.[1] Kritische Aspekte der Umweltpolitik der SED wurden dabei allerdings ausgeblendet.
Ist das nicht ein Widerspruch? Warum propagierte die DDR-Führung die Wertschätzung für die Natur, während sie gleichzeitig zuließ, dass die Umwelt durch Industrie und Landwirtschaft massiv zerstört wurde?
Der "sozialistische Mensch" wurde in der DDR-Ideologie als naturverbunden und verantwortungsbewusst dargestellt. Die Natur wurde als gemeinsames Erbe betrachtet, das es zu schützen und für künftige Generationen zu bewahren galt. Die Umwelterziehung sollte dieses Bewusstsein fördern. Gleichzeitig hatte aber das Wirtschaftswachstum absoluten Vorrang.[2] Umweltschutz war ein Bremsfaktor dabei. Um die Planwirtschaft am Laufen zu halten, wurde der Umweltschutz vernachlässigt. Ein weiterer Widerspruch zwischen ideologischem Anspruch und wirtschaftlicher Realität.
[1] In den DDR-Lehrbüchern wurden Umweltprobleme oft verharmlost dargestellt. Die beliebte Kinderzeitschrift "Trommel" veröffentlichte Artikel und Geschichten über Umweltschutz, die die Erfolge der DDR hervorhoben und die Probleme ausblendeten. Die Website "Jugendopposition.de" bietet Informationen und Zeitzeugenberichte über die Umweltbewegung in der DDR und beleuchtet auch die kritischen Aspekte der Umwelterziehung.
[2] Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bietet umfangreiche Informationen und Dokumente zur Umweltpolitik der DDR.
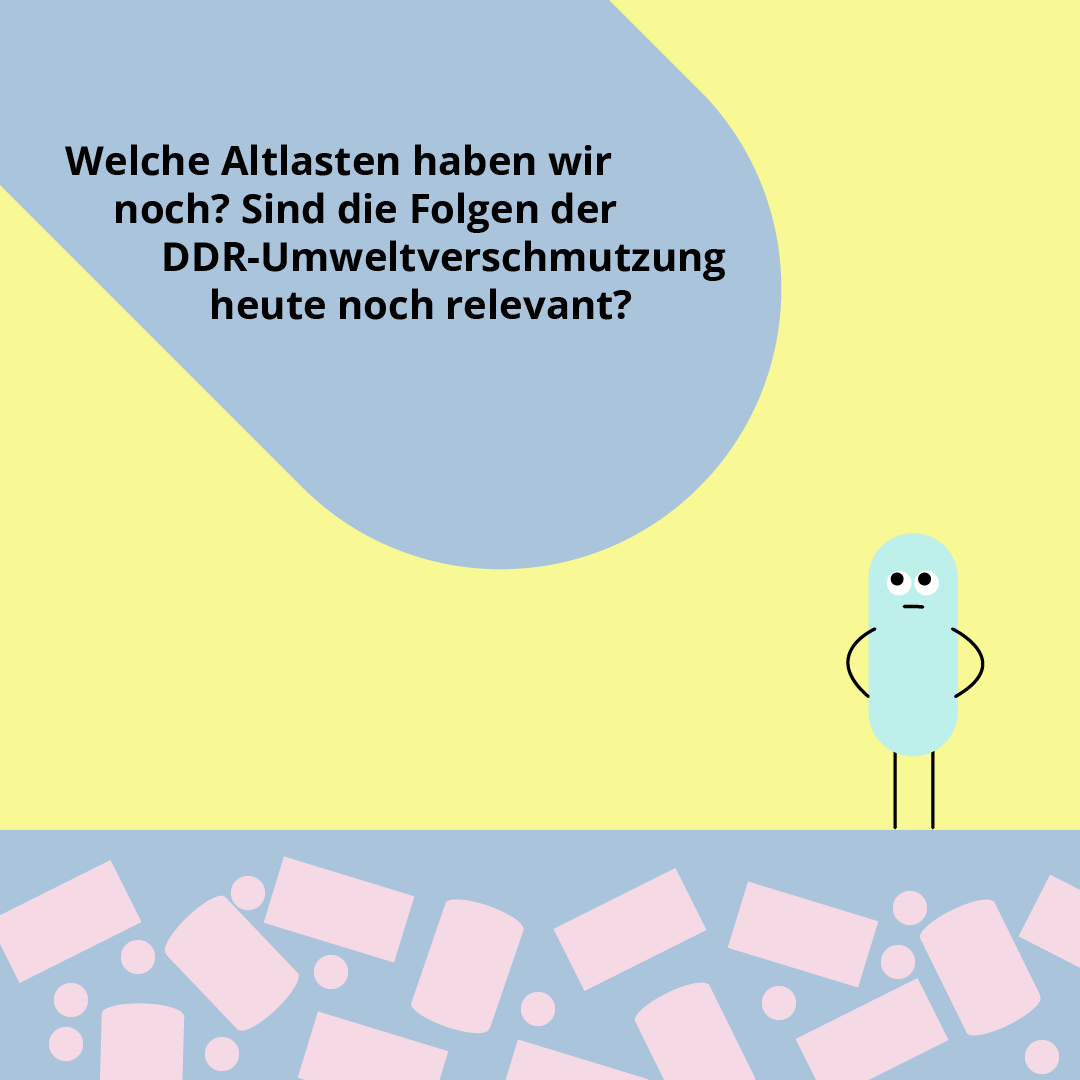
Jetzt seid ihr dran: Macht das Quiz und zeigt, was ihr euch gemerkt habt!